Vergesellschaftung?!
Eine Strategie gegen rechten Populismus und für eine sozial-ökologische Transformation
von Hamidou Maurice Bouguerra
Seit nunmehr dreißig Jahren wird der Osten der Bundesrepublik mit Krisen und Konflikten infolge des Strukturbruchs (siehe Glossar) mit dem Ende der DDR konfrontiert: strukturschwache Regionen, hohe Arbeitslosigkeit und ein demografischer Wandel durch den Rückgang der Bevölkerung. Der autoritäre Populismus (siehe Glossar) in Gestalt der AfD verzeichnet Erfolge bei Wahlen und schafft es zugleich, mit seiner Politik ein rechtes Weltbild mit den Abwertungs- sowie Deklassierungserfahrungen großer Teile der Ostdeutschen zu verbinden und so weiter in die Gesellschaft einzudringen (Neise 2020: 22).
Entgegen dessen, dass der Begriff des Strukturbruchs meist verwendet wird um radikale Transformationen zwischen zwei oder mehreren Zuständen zu beschreiben, findet er in den einschlägigen Lexika der Politik-, Sozial- und Staatswissenschaften keine Definition. Jedoch wird er oft im Zusammenhang mit den politischen, ökonomischen und kulturellen Umbrüchen im Rahmen der ‘Deutschen Wiedervereinigung‘ seit 1990 und der direkten Folgejahre verwendet (vgl. Holtmann 2020, Ragnitz 2020, Gürtler et al. 2020). Dabei seien für das Verständnis der Entwicklung Ostdeutschlands seit dem Ende der DDR „sowohl die inhaltlichen Größenordnungen des Umbruch als auch dessen typische Verlaufsformen kenntlich zu machen“ (Holtmann 2020). Ragnitz (2020) verwendet den Begriff vor allem, um die Deindustrialisierung des postsozialistischen Ostdeutschland und die resultierenden wirtschaftlichen Zustände zu beschreiben. Aus beiden Erklärungen lässt sich ableiten, dass Strukturbruch einen wesentlich disruptiveren Übergang, verbunden mit radikalen Umwälzungen, bezeichnet, als es der weichere Begriff des Strukturwandels tut.
Die Bezeichnung des autoritärer Populismus nach Sager (2019: 83f.) fokussiert sich auf rechte Bewegungen beziehungsweise Regime und kann folgenden Kriterien nach definiert werden:
Anti-Elitismus: Der autoritäre Populismus konstruiert ein moralisch reines ‘Volk’, das korrupten Eliten’ gegenübersteht (ebd.: 83).
Autoritäre Populist*innen lehnen jede Einschränkung des Ausdrucks des Volkswillens ab. (ebd.)
Anti-Pluralismus: Autoritäre Populist*innen behaupten, dass nur sie ‘das Volk’ vertreten, andere werden ausgeschlossen. Es kommt zu einer Artikulation eines singulären gemeinsamen Willens ‘des Volkes’, welcher von jemandem vorgetragen wird, der darauf besteht, ‘das Volk’ als Ganzes zu vertreten. (ebd.: 83f.)
Autokratie: Ein demokratischer Prozess ist unter autoritärem Populismus sinnlos, weil ‘das Volk’ mit einer Stimme spricht und andere kein Recht auf Anhörung haben. Die Regierungsgewalt liegt in den Hände eines ‘starken Führers’. (ebd.: 83f.)
Völkischer Nationalismus: Forderungen nach einer strengen und/oder diskriminierenden Politik gegenüber bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppen, die in das Land einreisen oder dort leben (ebd.: 84).
Die Entscheidungsträger*innen in der Politik sowie in der Planung beziehen sich in ihren Funktionen nur wenig auf die konkrete Lebenssituation der Menschen, wenn sie versuchen Lösungen zu entwickeln.
Diese politischen Entwicklungen stellen eine Reaktion auf die unterschiedlichen Krisen – der Repräsentation, der Partizipation und der Souveränität (Priester 2017) – dar, welche beispielsweise auch mit dem gegenwärtigen Strukturwandel (siehe Glossar) in den Lausitzen einhergehen. Gleichzeitig werden in den verschiedenen Teilräumen der Region die Konfliktlinien der Gesellschaft, „zwischen materieller und postmaterieller Werteorientierung, […] repräsentativer und direkter Demokratie, ein Identitätskonflikt zwischen Nativismus und Kosmopolitismus, sowie ein Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie“ (ebd.), sichtbar. Die Entscheidungsträger*innen in der Politik sowie in der Planung beziehen sich in ihren Funktionen nur wenig auf die konkrete Lebenssituation der Menschen, wenn sie versuchen Lösungen zu entwickeln; dementsprechend erscheint der lokalen Bevölkerung jeder Wandel als eine Bedrohung im Wesen des Fremdbestimmt-Seins, die abgewehrt werden müsse (Neise 2020: 22). In vielen Bereichen der Beteiligungsverfahren fehlen jene Akteur*innen der Gesellschaft, auf die es letztendlich ankommt: „die arbeitende Klasse des Ostens“ (ebd.). Es sollte nicht zu verkennen sein, dass die Menschen in den Landstrichen der Lausitzen mit einer Genugtuung auf das mit ihren eigenen Händen geschaffene Leben blicken, woraus sie ihren Stolz ziehen (ebd.: 23). Die Versuche der formellen sowie informellen Partizipation an Planungsprozessen scheitern oft, weil in der ostdeutschen Bevölkerung eine generelle Skepsis gegenüber jenen Gesellschaftsschichten besteht, die nicht in gleicher Weise ersichtliche Arbeit verrichten (ebd.). Nicht zuletzt sorgen „[v]ierzig Jahre politische Bevormundung durch die SED, gefolgte von dreißig Jahren wirtschaftlicher Bevormundung durch westdeutsche Eliten“ (ebd.) für ein großes Misstrauen bei den Ostdeutschen.
Wie Planung in der Praxis an den Bedürfnissen der Menschen im ländlichen Raum vorbeigeht, verdeutlicht dieses Video sehr eindrücklich.
Eine (planungs-)politische Lösung für die skizzierten Konflikte könnte darin liegen, möglichst früh alternative Ideen für Pläne zu entwickeln, die offen und kontrovers diskutiert werden können. Eine universalistische Perspektive eröffnet sich hier im Diskurs um die Vergesellschaftung von Privateigentum an Produktionsmitteln, Finanzvermögen und Infrastruktureinrichtungen.
Was tun?!
Der offensichtliche Widerspruch im Versprechen des Privateigentums, das eine individuelle Freiheit sichere und für eine Entfaltung von Effizienz und Erhöhung von Produktivität nötig sei, muss benannt werden. In diesem gesellschaftlichen Konstrukt setzt der Staat den Rahmen für die herrschende Ordnung. Es besteht die Grundüberzeugung liberaler ökonomischer Theorien, die in der privatwirtschaftlichen, gewinnorientierten Logik eine vermeintliche Effizienz des freien, sich selbst regulierenden Marktes, der durch private Eigeninitiative sowie seine Dynamik den Wettbewerb zu Innovation treibt, wodurch wiederum Wachstum und somit Wohlstand für alle entstehen würde. (vgl. Nuss 2020) Konkret geht es in der Forderung nach Vergesellschaftung von Privateigentum darum, die Grenze von Freiheit und Partizipation zu markieren. Diese Gegebenheit, welche den zentralen Widerspruch der (neo-)liberalen Ökonomie des Kapitalismus (siehe Glossar Neoliberalismus) bildet, postuliert demokratische Rechte, die mit der Ordnung des privaten Eigentums sogleich wieder aufgehoben werden (Zelik 2020: 91). „Wer über das entsprechende Vermögen verfügt, kann nicht nur, anders als Besitzlose, das eigene Leben frei gestalten, sondern beherrscht auch die politischen Entscheidungsprozesse“ (ebd.). Gegenwärtig werden durch das Privateigentum von Grund, Boden und (Re-)Produktionsmitteln relevante Teile der Bevölkerung systematisch vom Wachstum des gesellschaftlich geschaffenen Reichtums ausgeschlossen (Nuss 2020: 39f.). Diese soziale Ungleichheit zeigt sich auf lokaler Ebene dahingehend, dass die Möglichkeiten der Kommunen, planungspolitische Entwicklungen zu steuern, mit der fortschreitenden Neoliberalisierung (siehe Glossar) immer weiter zurückgehen. Im neoliberalen Kapitalismus werden die Nutzungsrechte, die eigentlich einer Bedürfnisbefriedigung des konkreten Bedarfs der Menschen dienen sollten, verweigert, worin sich ein konkreter Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Produktionsweise und Eigentumsbewusstsein erklärt. Die Forderung dieser klassenkämpferischen Position wird heute noch dringlicher, weil sich die ökologische Krise nicht ohne Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse und das supprimieren der Hegemonie der vermögenden Klassen bearbeiten lassen wird (Zelik 2020: 92). Es reicht nicht, die entstehenden Ungleichheiten lediglich durch politisches und planerisches Steuern zu korrigieren (ebd.: 95).
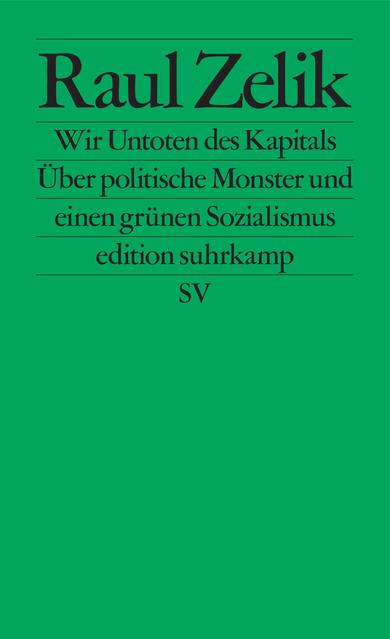
Im Schritt eines radikalen sozialen Transformationsprozesses steht nicht eine Destruktion der herrschenden Ordnung im Mittelpunkt, sondern die Konstruktion von solidarischen Beziehungsweisen, in denen die Macht des Kapitals über Leben und Gesellschaft zurückgedrängt wird (ebd.: 97). „Weder die Einführung von Gemeineigentum noch die Substitution von Tauschbeziehungen durch Planung stellen jene egalitären, demokratischen und solidarischen Verhältnisse her, die der Begriff der ‘klassenlosen Gesellschaft‘ impliziert“ (ebd.). Die politische Planung per se muss unter demokratische Kontrolle der lohnabhängigen Bevölkerung gestellt werden und die gesellschaftlichen Interessen wie die Verbesserung der Lebensbedingungen verwirklichen – dies setzt Kollektive voraus, die das Teilen von Gemeingütern organisieren und planen (ebd.: 98). Hierbei wird ein demokratisch bestimmter Zusammenschluss von Bewohner*innen geformt, der den Bedarf und das gesellschaftlich Erwünschte ermittelt, Produktion und Konsum der Güter beziehungsweise Dienstleistungen koordiniert sowie dem von natürlichen Ressourcen her Möglichen abwägt. Die historische Trennung der Menschen von ihren (Re-)Produktionsmitteln sollte von der Gesellschaft aufgehoben werden, um an dessen Stelle eine neue Verbindung von Arbeitskraft, Natur und (Re-)Produktionsmitteln im Sinne einer Selbstermächtigung aufzubauen. (vgl. Nuss 2020) Es kommt vor allem darauf an, Art und Weise der Verfügung über die (Re-)Produktionsmittel und die Arbeitsprozesse durch eine alternative gesellschaftliche Aneignungsweise neu zu gestalten (ebd.: 94f.). Jedoch wird es logischerweise nicht möglich sein, diesen Schritt von heute auf morgen zu realisieren, weil dieser Prozess der Verwirklichung einer Zukunft mit kooperativer Ökonomie und gesellschaftlichen Eigentum in der Praxis im Rahmen von kritischen, selbstreflektierenden Aushandlungsprozessen zunächst konkrete Formen annehmen muss.
Es ergibt mehr Sinn, soziale Kämpfe um Wiederaneignungen zu führen, die bereits in der Gegenwart umgesetzt werden können. Raul Zelik beschreibt passend einen „Infrastruktursozialismus“ (2020: 99), der im Kampf um institutionelle Rahmenbedingungen entscheidend sei, „auch wenn sozialistische Emanzipation nicht vom Staat, sondern von den gesellschaftlichen Organisierungsprozessen her gestaltet werden muss“ (ebd.). Mithilfe der demokratischen Vergesellschaftung von grundlegenden Gütern und (Re-)Produktionsmitteln in den Kommunen – hierzu gehören unter anderem Wohnen, Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Verkehrsnetze, Bildungswesen, Kinderbetreuung, Altenpflege, Gesundheitsversorgung, Kultur- und Freizeiteinrichtungen – wird es den Menschen in den Lausitzen möglich werden, die Raumnutzung grundlegend neu zu gestalten. Diese Bereiche der Daseinsvorsorge sollten nach Jahrzehnten der Privatisierung endlich der betriebswirtschaftlichen Verwertungslogik des Marktes entzogen werden. Denn „gesellschaftlicher Wohlstand [beruht] nicht auf individuellem Konsum, sondern auf sozialen und materiellen Infrastrukturen […]“ (ebd.). Ein erster Schritt könnte somit die Weiterentwicklung und der Ausbau bestehender politischer sowie planerischer Instrumente kommunaler Mitbestimmung in diesen Bereichen sein, um den sozialen Verwerfungen infolge der bevorstehenden Entwicklungen in den Lausitzen entgegenzuwirken. Wenn die Menschen in den Dörfern und Städten den Strukturwandel selbst in die Hand nehmen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich vor Ort die wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten einer Ökologisierung bilden, die nicht passiv sondern vielmehr aktiv stattfindet (Thie 2020: 27). Mit diesem Vorhaben könnte so „eine Gemeinwirtschaft mit einem mehrdimensionalen ‘Return of Initiative’ entstehen: schnellere und kostengünstigere Energiewende, mehr Souveränität statt Abhängigkeit von externen Investoren, Stärkung der kommunalen Demokratie und der lokalen Steuerbasis“ (ebd.: 29).
Fazit
Um letztlich dem Wunsch der ostdeutschen Bevölkerung gerecht zu werden, über das eigene gesellschaftliche Leben bestimmen und den sozialen Raum eigenständig zum Besseren verändern zu können, sollten also die herrschenden Verhältnisse durch Politiker*innen sowie Planer*innen – welche mit ihren Planungen solche Kollektivgüter der Gesellschaft schaffen – grundlegend in Frage gestellt werden. Selbstverständlich bilden hierbei konkrete Visionen und detaillierte Lösungsvorschläge einen wichtigen Teil, mit dem die Gesellschaft eine kollektive Verfügungsmacht über die Produktionsmittel erreichen könnte, die zu lebensfreundlichen Bedingungen führt. Gleichzeitig müssen diese Projekte einer nachhaltigen sowie demokratischen Ökonomie die soziale Sicherheit für die Betroffenen herausstellen, weil sonst entstehende Abwehrhaltungen der lohnabhängigen Klasse im Osten jegliches progressives Vorhaben behindern könnte (Neise 2020: 24). Auch sollten diese konzeptionellen Impulse von einem politischen Rückenwind unterstützt werden, in dem in bestehenden Kommunalverfassungen, in Finanzierungs- und Verkehrsplänen, in Vergabe- und Energiegesetzen die Hindernisse für eigenständiges, lokales Handeln beseitigt werden (Thie 2020: 29).
Die Selbstermächtigung durch eine Vergesellschaftung der Lebensgrundlagen würde den Lausitzer*innen letztendlich eine Verfügungsgewalt zurückgeben, mit der die Menschen nach ihren eigenen Standards, Bedürfnissen sowie Wünschen aus den Dörfern und Städten solidarische ländliche Gemeinschaften machen könnten.
Die Selbstermächtigung durch eine Vergesellschaftung der Lebensgrundlagen würde den Lausitzer*innen letztendlich eine Verfügungsgewalt zurückgeben, mit der die Menschen nach ihren eigenen Standards, Bedürfnissen sowie Wünschen aus den Dörfern und Städten solidarische ländliche Gemeinschaften machen könnten (Neise 2020: 24). So wird es möglich, die Krisen von Partizipation, Souveränität und Repräsentation – die zugleich den Nährboden des autoritären Rechtspopulismus bilden – effektiv zu lösen und den Weg für eine sozial-ökologische Transformation durch die Gesellschaft selbst zu ebnen.
Hier kannst Du einen Kommentar hinterlassen!

Neise, Martin. 2020. Vom Feeling her ein ostdeutsches Gefühl. Ost New Deal. JACOBIN Magazin (3): 22–25.
Nuss, Sabine. 2019. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums. Berlin: Karl Dietz Verlag.
Priester, Karin. 2017. Das Syndrom des Populismus. Dossier: Rechtspopulismus. (Zugriff: 05.01.2021) URL: https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/240833/das-syndrom-des-populismus.
Thie, Hans. 2020. Green New Deal von unten. Ost New Deal. JACOBIN Magazin (3): 26–29.
Zelik, Raul. 2020. Sozialismus, aber anders. Durch Selbstermächtigung zur befreiten Gesellschaft. Blätter für deutsche und internationale Politik (8’20): 91–100.